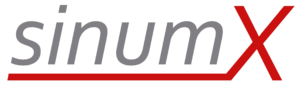Luftbild Umwelt Planung GmbH (LUP) Die Luftbild Umwelt Planung GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien für Umwelt- und Naturschutzprojekte an der Schnittstelle von Fernerkundung, künstlicher Intelligenz und nachhaltigem Ressourcenmanagement. Unsere Expertise umfasst die Bereitstellung von hochpräzisen, digitalen Lösungen zur Analyse und Bewertung ökologischer Prozesse – eine Grundlage für wirkungsvolle und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen im natürlichen Klimaschutz. Unser Institut wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, Umweltinformationen vorwiegend aus der Fernerkundung nutzbar und für die Zwecke von Umweltanalytik und Umweltplanung anwendbar zu machen. Tatsächlich arbeiten wir seit nunmehr mehr als 25 Jahren nicht nur im Bereich der Verarbeitung von Luft- und Satellitenbilddaten für Umweltfragen, wir führen nach wie vor Naturschutz- und Landschaftsplanungsprojekte als auch gutachterliche Tätigkeiten im Naturschutz und im Klimaschutz durch. So sind wir zum Beispiel an konkreten Vorhaben bei der Wiedervernässung von Niedermooren in Brandenburg ebenso beteiligt, als auch an Klimaschutzkonzepten auf der Ebene der Bundesländer. Zuletzt haben wir für das Land Brandenburg im Rahmen des Klimaplans Brandenburg die fachliche Leitung der Sektoren Landwirtschaft und LULUCF innegehabt. In dieser in 2023 vom Landtag beschlossenen Strategie werden sowohl die Analyse von Zustand und Emissionen für alle landwirtschaftlichen- und LULUCF Subsektoren und verschiedene Variantendarstellungen in Szenarien durchgeführt, als auch eine Vielzahl von Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität im Bereich des natürlichen Klimaschutzes vorgeschlagen. Damit nimmt unser Institut insgesamt sowohl die Rolle des Datenerstellenden als auch die Rolle des Datennutzenden ein. Das Verständnis nach notwendiger Art und Inhalt von Informationen für die konkrete Umwelt- und Klimaschutzplanung leitet sich daher in der Regel aus unseren eigenen Projektbedarfen ab. Im Rahmen dieses wegweisenden Projekts bündeln wir unser Know-how, um modernste fernerkundungsbasierte Dienste zu entwickeln, die den natürlichen Klimaschutz stärken. Mit Fernerkundungstechnologien und datengetriebener Modellierung schaffen wir neue Möglichkeiten, Wälder, Moore, und andere Handlungsfelder des ANK gezielt zu schützen, wiederherzustellen und an den Klimawandel anzupassen. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis entwickeln wir zentrale Dienste, die die Grundlage für nachhaltige Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz bilden. https://lup-umwelt.de/ Beteiligung an den Diensten: Biotoptypen Vitalität Versiegelung Grünflächen Hitzebelastung DUENE e.V. Der wissenschaftliche gemeinnützige Verein „Institut für Dauerhaft Umweltgerechte Entwicklung von Naturräumen der Erde e.V.“ (DUENE) wurde am 1999 von überwiegend ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern des Botanischen Instituts der Universität Greifswald gegründet. Der aktuelle Vorstand besteht aus Dr. Michael Manthey (Vorsitzender), Dr. Michael Rühs, Achim Schäfer, Anke Nordt und Dr. Wendelin Wichtmann. Das Hauptziel von DUENE ist es, die nachhaltige Entwicklung von Landschaften zu unterstützen durch: – landschaftsökologische und ökonomische Forschung, Die aktuelle Forschung beschäftigt sich etwa mit Fragen der Wirtschaftlichkeit von Paludikulturen sowie der Produktivität und Nutzbarkeit von Feuchtgebietspflanzen und der Entwicklung von Ansätzen zur Quantifizierung und Monetarisierung von Ökosystemleistungen. Weitere Aktivitäten befassen sich mit der Verbesserung und Wiederherstellung degradierter Standorte unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. DUENE vermittelt Fachwissen und Wissen in Form von Fortbildungskursen. Die Themen reichen von Moorrestaurierung und Moor- und Torfcharakterisierung bis hin zur Vermittlung des GEST-Konzepts, einem Ansatz zur Abschätzung von Treibhausgasemissionen mit der Vegetation als Proxy. DUENE ist seit Gründung (2015) Partner im Greifswald Moor Centrum (GMC). Die Universität Greifswald, die Michael Succow Stiftung und DUENE e.V. arbeiten am Standort Greifswald als eigenständige Institutionen mit unterschiedlicher Expertise in Bezug auf Moore. Das Greifswald Moor Centrum ist eine strategische Kooperation zwischen diesen drei Institutionen – als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in allen Moorfragen, lokal und weltweit. Im GMC arbeiten ca. 135 Moorkundige aller Art an einem Standort. Auf wissenschaftlicher Grundlage bietet das GMC zielgerichtete Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen. Am GMC wird die weltweit größte Datenbank “Global Peatland Database” zu Verbreitung und Zustand der Moore koordiniert. Die umfangreiche Bibliothek „Peatland and Nature Conservation International Library“ (PeNCIL) ist Teil des GMC. Das Greifswald Moor Centrum ist Gründungsmitglied der Global Peatlands Initiative. Beteiligung an den Diensten: Technische Universität Berlin – Fachgebiet Geoinformation in der Umweltplanung Das Fachgebiet Geoinformation in der Umweltplanung an der Technischen Universität Berlin gehört zu den führenden Einrichtungen in der Analyse und Entwicklung von Geoinformations- und Fernerkundungstechnologien zur Analyse natürlicher Vegetation. Unser Schwerpunkt liegt auf der Nutzung hochmoderner Daten aus verschiedenen Sensoren und Zeitreihen, die von UAV-, Luftbild- und Satellitensystemen stammen, um präzise Einblicke in ökologische Prozesse und die Biodiversität von Ökosystemen zu gewinnen. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Waldmonitoring, wo wir innovative Verfahren zur Analyse von Waldmerkmalen und zur Bewertung der Waldvitalität entwickeln. Erfahrungen aus Projekten wie FirST2.0 und FeMoPhys fließen dabei ein und tragen dazu bei, Methoden wie automatisierte Klassifikation, KI-Anwendungen und datengetriebene Modellierung effektiv einzusetzen. Mit diesen Ansätzen können wir Baumarten präzise identifizieren, Vitalitätszustände bewerten und strukturelle Eigenschaften von Wäldern ableiten. Auf diese Weise leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Auswirkungen von Klimawandel und Landnutzungsänderungen auf Wälder besser zu verstehen und Maßnahmen zur Erhaltung sowie Wiederherstellung von Waldökosystemen zu entwickeln. Ein aktuelles Forschungsfeld ist die Detektion von Waldschäden, die durch Feuer, Stürme, Trockenheit oder Schädlingsbefall verursacht werden. Mit modernen Fernerkundungs-technologien können Schäden erkannt, deren räumliche Ausbreitung dokumentiert und die ökologischen Folgen analysiert werden. Unsere Arbeitsgruppe verbindet Grundlagenforschung mit praxisnahen Anwendungen, um innovative Lösungen für den Umwelt- und Klimaschutz zu entwickeln. Mit Hilfe von Fernerkundungstechnologien und Geoinformationssystemen tragen wir dazu bei, die Biodiversität zu fördern, Ökosysteme wie Wälder langfristig zu schützen, wiederherzustellen und nachhaltig zu bewirtschaften. Weitere Informationen zu unseren Forschungsschwerpunkten und Projekten finden Sie unter: www.geoinformation.tu-berlin.de. Contribution to the Services: GFZ/FERN.Lab Das FERN.Lab ist eine Arbeitsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ)*, die sich auf den Wissens- und Technologietransfer von Fernerkundungsforschung, -methoden und -daten spezialisiert hat. Unsere Expertise liegt in der Operationalisierung von Forschungssoftware (SaaS), der Anpassung von Fernerkundungsmethoden und dem Kapazitätsaufbau durch partizipative und Co-Design gestaltete Erstellung von Bildungs- und Schulungsmaterialien. Das GFZ ist eine führende wissenschaftliche Einrichtung in Potsdam, Deutschland, die sich der Erforschung von Prozessen des Erdsystems widmet. Als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft konzentriert es sich auf Geophysik, Geodäsie, Geochemie, Seismologie, Geothermie, Erdbeobachtung und Klimaforschung und adressiert globale Herausforderungen wie Naturgefahren, Klimawandel und Ressourcennachhaltigkeit. Das GFZ integriert interdisziplinäre Expertise und betreibt modernste Infrastruktur, darunter Satellitenmissionen wie der deutsche Hyperspektralsatellit EnMAP. Es ist bekannt für seine globalen Kooperationen und leistet Beiträge zu internationalen geowissenschaftlichen Initiativen, wie der Bewertung seismischer Gefahren und Klimaanpassungsstrategien, während es Bildung, Forschung und Wissenstransfer aktiv unterstützt. Gegründet 1992 auf dem historischen Telegrafenberg in Potsdam, verbindet das GFZ Grundlagenforschung mit angewandten Lösungen, um das Verständnis dynamischer Prozesse der Erde voranzutreiben. Im Rahmen dieses Projekts entwerfen wir Schulungen zur Nutzung von EO-Daten und Methoden im Bereich der Umweltüberwachung. Die Konzeption der Schulungsangebote wird konkret an die Bedarfe öffentlicher Behörden (Bundes-, Landes- und Kommunalebene) sowie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Privatpersonen angepasst, um so eine effektive und nachhaltige Nutzung in der Praxis zu gewährleisten. Projekte – FERN.Lab website: https://fernlab.gfz.de/ – FERN.Lern website: https://fernlern.gfz.de/ – EO-College: https://eo-college.org/ – HyperEdu: https://www.enmap.org/events_education/hyperedu/ Ignite Education Ignite Education ist ein spezialisiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung und Optimierung anspruchsvoller eLearning-Lösungen widmet. Mit einer starken Verankerung in der Erdbeobachtung haben wir umfangreiche Erfahrungen in der Aufbereitung komplexer Daten und Konzepte gesammelt. Dieses Fachwissen nutzen wir, um innovative Bildungsansätze zu schaffen, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisnah sind. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erstellung strukturierter und konzeptionell durchdachter Lerninhalte, die die Bedürfnisse von Fachexpert*innen und Lernenden gleichermaßen bedienen. Wir priorisieren eine klare und konsistente Wissensvermittlung, um eine fundierte und nachhaltige Lernbasis zu gewährleisten. Dabei berücksichtigen wir die kognitiven Anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen, um Inhalte sowohl didaktisch optimal als auch flexibel anpassbar zu gestalten. Ergänzend zur Content-Entwicklung implementieren wir technologische Lösungen, die Lernprozesse gezielt unterstützen. Dies umfasst die Integration digitaler Plattformen, die innovative Technologien wie Automatisierung und Large Language Models (LLMs) nutzen. Diese Systeme ermöglichen es, komplexe Daten effizient zu analysieren, repetitive Aufgaben zu automatisieren und personalisierte Bildungsansätze zu fördern. Durch die Verknüpfung von Automatisierung mit didaktischen Prinzipien tragen wir zur Optimierung der Lernumgebung bei. Unser Ziel ist es, Bildungslösungen zu entwickeln, die nicht nur inhaltlich exzellent, sondern auch nachhaltig und adaptiv sind. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen, Schulen und führenden Branchenakteuren, um wissenschaftlich fundierte und praxisrelevante Ansätze zu garantieren. Unsere Projekte zielen darauf ab, Bildung umfassend neu zu denken und so langfristige Lösungen zu schaffen, die sich den wandelnden Anforderungen einer globalisierten Wissensgesellschaft anpassen. Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) ist eine technisch-wissenschaftliche Fachbehörde, die zudem im Verbraucherschutz Vollzugsaufgaben wahrnimmt. Gemäß § 3 Landesnaturschutzgesetz hat das LANUK den Auftrag, den Zustand des Naturhaushalts und dessen Veränderungen – Klimawandel und Umweltschutzmaßnahmen eingeschlossen – zu ermitteln, auszuwerten, zu bewerten. Dies erfolgt methodisch und inhaltlich in Abstimmung mit anderen Ländern und dem Bund. Auch die Schutzgebietsbeobachtung, die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die Landschaftsplanung, sowie die Schulung und wissenschaftliche Betreuung von im Naturschutz und der Landschaftspflege tätigen Dienstkräfte und Ehrenamtlichen gehören zu den gesetzlichen Aufgaben des LANUK. Im Rahmen der neuen Aufgabe Kommunalberatung Klimafolgenanpassung berät das LANUK darüber hinaus seit 2024 zum Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben bündelt das LANUK Expertise zu Natur-, Boden-, Gewässer- und Klimaschutz, und betreibt diverse Monitoring-Programme, welche den Zustand von Natur und Umwelt fortlaufend erfassen und bewerten. Die Ergebnisse werden in Fachinformationssystemen (FIS) vorgehalten, aus denen sich Berichte erstellen und (interne) Handlungsbedarfe ableiten lassen. Viele dieser FIS stellen auch detailreiche Informationsangebote für die Öffentlichkeit dar, beispielsweise der Klimaatlas NRW. Um die nach § 5 Landesnaturschutzgesetz regelmäßig durchzuführende terrestrische Biotopkartierung zielgerichteter und effizienter zu gestalten und um zusätzliche Aspekte flächendeckend und sehr viel zeitnaher als bisher zu erfassen, hat das LANUK ab 2013 drittmittelfinanziert den Einsatz von Fernerkundung erprobt und dann 2020 ein hauseigenes Fernerkundungskompetenzzentrum (FEKZ) eingerichtet. Ergebnis des ersten Drittmittelprojekts, durchgeführt in Kooperation mit der EFTAS GmbH, war die Pilot-Software „FELM“, die es seitdem auch fernerkundlich wenig geschulten Sachbearbeitenden ermöglicht, Fernerkundungsdaten im behördlichen Natura-2000-Monitoring so zu nutzen, dass Vorkommen und etwaige Zustandsänderungen von Flächen mit FFH-Lebensraumtypen (LRT) effizienter aufgespürt werden können. In einem zweiten Drittmittelprojekt („NUMO-NRW“) konnten mit Hilfe persönlicher Interviews weitere fachlich begründete Bedarfe an Fernerkundungsdaten im LANUK ermittelt werden. Illustriert wurde der Mehrwert von Fernerkundung in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) in Form einer neuen Karte zur Erfolgskontrolle durchgeführter Maßnahmen zur Stärkung des Biotopverbunds in den Rheinauen. Dabei konnte das LANUK auch wertvolle Erfahrungen gewinnen was das länderübergreifende Monitoring einer Schutzgebietskulisse betrifft. Mit dem Ziel, vorhandene behördliche Ressourcen besser zu bündeln und durch Skalierbarkeit und (ressortübergreifende) Nachnutzbarkeit Synergien zu erzeugen, wirkte das LANUK 2018 als Triebkraft für die Einrichtung der sog. Copernicus Dateninfrastruktur beim Landesbetrieb IT.NRW. Auch dank der Offenen Datenpolitik des Landes NRW nimmt die Zahl der Datenprodukte und Berechnungsdienste auf dieser behördenweit nutzbaren Speicher- und Prozessierungsumgebung kontinuierlich zu. Jüngster Zuwachs ist die vom LANUK beauftragte und mitkonzipierte, erste landesweite Bodenversiegelungskarte aus Luftbildern, die auch für mehrere klimaschutzbezogene Fragestellungen von Interesse ist (Hitzebelastung, Starkregen, Bodenfunktionsverluste). Im 2024 abgeschlossenen Umweltleuchtturmprojekt „CopGruen“ lag neben der Entwicklung eines Dienstes zur Ableitung potentieller Flächen mit FFH-Lebensraumtyp „Mähwiese“ auch die Projektkoordination in den Händen des LANUK. Damit sollte eine pragmatische und praxisnahe Ausrichtung an den Bedarfen der Landesumweltämter erreicht werden. Workshops mit Stakeholdern aus zehn Bundesländern und wöchentliche Videokonferenzen der sechs Verbundpartner aus Verwaltung, Forschung, und Privatwirtschaft stellten sicher, dass die Durchführung effizient und zielorientiert erfolgte. Die Projektergebnisse finden sich mittlerweile auf der Plattform CODE-DE in Form mehrerer fernerkundungsbasierter Auskunftsdienste zu den Themen Mahdregime, Mähwiesen-Lebensraumtyp, Grünlandumbruch, Heideverbuschung und Überstau auf organischen Böden. Im vorliegenden Projekt EO4Nature wirkt das LANUK ebenfalls in zwei Rollen mit. Zum einen verantwortet es die Entwicklung eines fernerkundungsbasierten Berechnungsdienstes für einen Indikator zur Klimawirksamkeit von Auenlandschaften. Dabei sollen naturschutzfachlich sinnvolle und fernerkundlich messbare Biotoptypengruppen differenziert werden, um zugleich praxisrelevante Handlungsoptionen für naturbasierte Klimaschutzmaßnahmen aufzeigen. Zum anderen übernimmt das LANUK die Rolle des (nicht nur) behördlichen Praxispartners mit Aufgaben wie Bedarfsanalyse und Stakeholdereinbindung, Referenzdatenbeschaffung, Evaluierung der Dienstergebnisse, Dokumentation, sowie Mitwirkung bei adressatengerechter Portalgestaltung. Beteiligung an den Diensten: SinumX GmbH Die sinumX GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung moderner Systeme zur Erfassung und Abbildung von internen oder fachbezogenen Arbeitsabläufen. Im Rahmen der angebotenen Prozessanalysen werden dabei abstrahierte Funktionsschemata entwickelt, die in mehreren Schichten technisch abbildbar sind. Naturgemäß sind diese Leistungen fach- und sachunabhängig, jedoch haben sich inhaltliche Schwerpunkte gebildet, in denen vorrangig gearbeitet wird. Einen wesentlichen Bereich stellt die Entwicklung von webbasierten Lösungen für die Umweltforschung dar. Die digitale Abbildung von spezifischen Fragestellungen erlaubt es, Daten so zu erfassen und zu aggregieren, dass quantitative wie qualitative Aussagen daraus folgend möglich sind. Zudem ist die Interaktion der Nutzenden untereinander, auch interdisziplinär, häufig eines der Anliegen digitalen Arbeitens. Ein aktuelles Beispiel für eine unserer Entwicklungen auf diesem Gebiet ist die Strategiefolgenabschätzung des Umweltbundesamts. Im Bereich der räumlichen Planung liegt ein weiteres Tätigkeitsfeld. So wie bei der ständig notwendigen Anpassung an neu IT-Techniken, Libraries und Protokolle, ist der Planungsbereich ebenfalls durch neue Gesetze und Verordnungen einem steten Wandel unterworfen. Dafür hat die sinumX GmbH eine parametrisierte Datenbank entworfen und implementiert, auf deren Basis jedwede Prozessänderung umgesetzt werden kann, ohne das Datenmodell ändern zu müssen. In Kombination mit fortlaufenden Statistikdaten und einer umfassenden WebGIS-Lösung ist z.B. im Auftrag der LUP das Planungsinformationssystem Berlin-Brandenburg (PLIS) entstanden. Weitere Arbeitsbereiche der sinumX GmbH sind im Teilnehmermanagement angesiedelt. Neben umfassenden Logistiken zu den Abläufen sowie von der Registrierung der Teilnehmer bis hin zur digitalen Regelung von Sicherheitsfragen existiert ein breites Leistungsangebot. In unserer Gesamtbetrachtung sind es schließlich alles nur Daten, die möglichst effizient und sicher organisiert werden müssen. Das ist immer unser Kernanliegen. Thünen Institut Das Thünen-Institut ist das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Die Forschung am Thünen-Institut zielt darauf ab, Konzepte für eine nachhaltige, ökologische und wettbewerbsfähige Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Forstwirtschaft, Meeresfischerei und Aquakultur zu entwickeln. Unsere fast 1200 Mitarbeiter forschen für Politik und Gesellschaft in 15 Fachinstituten, die über ganz Norddeutschland verteilt sind. Mit der Thünen-Fernerkundung besteht am Thünen-Institut seit 2019 eine Verbundstruktur, die sich übergreifend über die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Meeresfischerei mit der Erstellung und Auswertung von Erdbeobachtungs-Satellitendaten beschäftigt. Die flächendeckende, bundesweite Abbildung der Nutzung, sowie des Zustands und der Veränderung der Land- und Meeresoberfläche stellen eine wesentliche Grundlage für die Bewertung von Nutzungsoptionen sowie für die Evaluierung der Maßnahmenumsetzung im Umwelt- und Klimaschutz dar. Die Aufgabe des Thünen-Instituts im Vorhaben besteht in der Entwicklung von bundesweit flächendeckenden Diensten für die ANK-Toolbox als Voraussetzung für ein umfassendes Umweltmonitoring im Bereich des Natürlichen Klimaschutzes. Dies beinhaltet eine Reihe von Indikatoren, die grundsätzlich geeignet sind, ein Maßnahmenmonitoring und eine Evaluierung für das ANK aber auch darüber hinaus zu unterstützen. Zudem liefern sie eine wesentliche Datengrundlage für die Verbesserung der räumlich-expliziten Modellierung von THG-Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsveränderung und Waldbewirtschaftung (LULUCF). Beteiligte Fachinstitute: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft Beteiligung an den Diensten: Urbetho CF GmbH Die Urbetho CF GmbH ist ein inhabergeführtes, deutsches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Erdbeobachtung und Cloud Computing. Das Team von Urbetho besteht aus Experten in den Bereichen Geoinformationstechnologie, Cloud-Infrastruktur und -Support sowie Projektmanagement und Business Development. Zusammen mit seinem internationalen Partnernetzwerk unterstützt Urbetho sowohl Kunden aus dem behördlichen Umfeld als auch aus Forschung und Industrie. Die Leistungen von Urbetho stehen dabei sowohl Nutzern als auch Anbietern und Betreibern von EO Clouds zur Verfügung: Nutzer: Das engagierte Supportteam von Urbetho ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Cloud-Nutzung und hilft mit Schulungen, umfangreichem Trainingsmaterial und individuellen Workshops bei einer an die Bedarfe angepassten Gestaltung und effizienten Nutzung der Cloud-Infrastruktur. Anbieter: Mit der langjährigen Erfahrung in der Forschung und in industriellen Anwendungen in Europa, den USA und Asien berät Urbetho die Anbieter von Daten und Anwendungen bei der Skalierung ihrer Services, beim Onboarding auf EO-Clouds und bei der Integration von Anwendungen in Cloud-Marktplätze. Betreiber: Urbetho unterstützt Betreiber von EO-Clouds und Plattformen dabei, ihr Angebot so weit wie möglich auf die Bedürfnisse der Nutzer zuzuschneiden und die Nutzung der Plattformen zu vereinfachen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erweiterung der Kundenbasis und der Community rund um diese Clouds. Urbetho ist Repräsentant von CloudFerro in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Vertriebs- und Lösungspartner bietet Urbetho die Cloud Dienstleistungen von CloudFerro an und leistet Fachsupport für alle Kunden der Public CloudFerro Clouds aus diesen Regionen. Zu den wichtigsten Projekten von Urbetho zählen die EO-Plattformen CODE-DE für Behörden und EO-Lab für Forschungsprojekte. Bei diesen im Auftrag des DLR betriebenen Clouds ist Urbetho der Ansprechpartner für alle Nutzer und deren spezifische Anforderungen. Link zu CloudFerro: https://cloudferro.com/
https://forestwatch.lup-umwelt.de/
http://urbangreeneye.de/
– Forschung zur Revitalisierung und nachhaltigen Nutzung von Landschaften,
– Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen
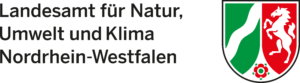

Beteiligte
Luftbild Umwelt Planung GmbH (LUP) Beteiligung an den Diensten: Biotoptypen Vitalität Versiegelung Grünflächen Hitzebelastung
Beteiligung an den Diensten: